Farben mischen – klingt erstmal einfach. Ein bisschen Rot, ein bisschen Gelb, und schon hast du ein wunderschönes Orange. Ganz so simpel ist es dann doch nicht! In Wirklichkeit steckt hinter dem Farbmischen eine ganze Welt voller Überraschungen, Missverständnisse und Aha-Momente. Aber keine Sorge – ich nehme dich mit auf eine kleine Reise durch die Farbenlehre und zeige dir, wie du Farben gezielt und mit Spass einsetzen kannst.
Warum das Ganze?
Neben meiner Leidenschaft für Epoxidharz (auch Resin genannt) male ich sehr gerne mit Öl, und genau diese Technik hat mir gezeigt, dass Farben nicht nur „schön bunt“ sind, sondern echte Persönlichkeiten haben. Mal sind sie launisch, mal harmonisch – und wenn man sie nicht versteht, machen sie einfach, was sie wollen. Doch sobald man sich mit ihnen anfreundet, eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten, egal ob mit Tinte, Acryl oder Pigmentpulver.
Ein Buch, das mir in Sachen Farben die Augen geöffnet hat, ist „The Oil Painter’s Color Handbook“ von Todd M. Casey. Es ist wie ein Reiseführer durch die bunte Welt der Farbtheorie – sehr zu empfehlen, wenn du Farben besser kennenlernen möchtest (und ja, man kann sich durchaus in sie verlieben).
Die Basics – Farben sind wählerisch
Bevor wir ins Mischen einsteigen, erstmal ein bisschen Theorie. Denn ohne die richtigen Grundlagen wird das Ganze schnell zur Lotterie.
Das Farbsystem, das die meisten Künstler verwenden, basiert auf dem sogenannten RBG- oder CMY-Modell. Doch für die Malerei ist das RYB-Farbsystem (Rot, Gelb, Blau) am weitesten verbreitet. Und hier kommt die erste Erkenntnis: Farben lassen sich in drei Kategorien unterteilen – die Primadonnen, die Teamplayer und die Farbalchemisten - die Experten der Zwischentöne.
Primärfarben: Rot, Gelb und Blau – die Unantastbaren. Sie lassen sich nicht durch Mischen erzeugen und sind die Basis für alles andere.
Sekundärfarben: Orange, Grün, Violett – entstehen durch das Mischen von zwei Primärfarben und sind die „Aha-Effekt“-Farben.
Rot + Gelb = Orange
Blau + Gelb = Grün
Rot + Blau = Violett
Tertiärfarben: Diese entstehen, wenn sich eine Primär- und eine Sekundärfarbe zusammentun –wie etwa Blaugrün oder Gelborange. Sie sorgen für die feineren Nuancen.
Kleiner Tipp: Wenn du Primär- und Sekundärfarben im richtigen Verhältnis mischst, kannst du fast jede Farbe selbst kreieren. Klingt cool, oder?
2. Farbton, Sättigung, Helligkeit – oder warum nicht jedes Blau gleich ist

Ein zentraler Aspekt des Farbmischens ist das Verständnis von Farbton, Sättigung und Helligkeit. Diese drei Eigenschaften bestimmen den Charakter und die Wirkung einer Farbe und sind entscheidend, um die richtige Atmosphäre in einem Bild zu erzeugen.
Farbton hängt von der Frequenz oder Wellenlänge des Lichts ab, wobei jede Farbe, wie Rot oder Blau, einer bestimmten Frequenz zugeordnet ist. Farben mit hoher Frequenz erscheinen blau, während niedrige Frequenzen rot wirken.
Intensität oder Sättigung beschreibt die Intensität oder Reinheit einer Farbe. Eine stark gesättigte Farbe ist lebendig und kräftig, während eine weniger gesättigte Farbe eher stumpf und gedämpft wirkt. Beim Mischen von Farben kann man die Sättigung verringern, indem man Grautöne oder Komplementärfarben hinzufügt.
Helligkeit (Tonwert) bezieht sich auf den Anteil von Licht in einer Farbe. Eine helle Farbe enthält viel Weiss oder ist von Natur aus leuchtend, während eine dunkle Farbe viel Schwarz oder tiefere Töne enthält. Mit Helligkeit zu spielen, lässt uns helle, luftige Stimmungen erzeugen oder dunkle, dramatische Effekte schaffen.
Das Zusammenspiel dieser drei Komponenten eröffnet unzählige Möglichkeiten, um die Farben im Bild zu steuern.
3. Warme und kalte Farben – Gefühlssache oder doch mehr?
Ein weiteres wichtiges Konzept beim Farbmischen ist die Unterscheidung zwischen warmen und kalten Farben:
Warme Farben wie Rot, Orange und Gelb erinnern an Sonnenuntergänge und vermitteln Energie, Leidenschaft und Nähe. Sie bringen Leben und Intensität ins Bild und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.
Kalte Farben wie Blau, Grün und Violett lassen uns an Ozeane und schattige Wälder denken. Sie wirken beruhigend und distanziert. Sie schaffen Raum und Tiefe und haben eine entspannende, manchmal auch melancholische Wirkung.
Beachte, dass bei der Unterscheidung zwischen kalten und warmen Farben nicht nur die Farben selbst, sondern auch die unmittelbar benachbarten Farben im Farbkreis eine Rolle spielen. Zum Beispiel sind warme Blau- und Grüntöne, die einen leichten Violett- oder Rotschimmer haben, tatsächlich „wärmer“, während kalte Blau- und Grüntöne, die mehr in Richtung Blaugrün oder Gelb tendieren, als „kälter“ wahrgenommen werden. Farben sind eben komplexe Wesen! Diese feineren Unterschiede in den Farbtönen und -nuancen machen das Arbeiten mit Farben noch interessanter und ermöglichen Dir, gezielt bestimmte Stimmungen und Effekte zu erzeugen.
4. Komplementärfarben – Der Kontrast der Gegensätze
Komplementärfarben liegen sich im Farbkreis gegenüber (z.B. rot und grün) und sind sogenannte Ergänzungsfarben. Sie erzeugen einen besonders starken Kontrast, wenn sie nebeneinander verwendet werden.
Diese Farben verstärken sich gegenseitig, was zu einer intensiven Wirkung führt. Das Besondere an Komplementärfarben ist, dass sie nicht nur visuell kontrastierend wirken, sondern auch die Wahrnehmung der jeweiligen Farbe intensivieren. Stell dir beispielsweise einen knalligen blauen Hintergrund vor, dem du ein kräftiges Orange dagegen setzt - BOOM! Dein Blau wirkt jetzt noch lebendiger und dein Orange intensiver.
Mischt man Komplementärfarben, entstehen neutrale Töne wie Grau oder Braun. Klinkt unspektakulär, ist aber der Schlüssel zu mehr Tiefe! Denn so können wir unsere Farbtöne dämpfen und realistischere Schattierungen erzeugen.
Wer Komplementärfarben clever einsetzt, verleiht seinem Bild das gewisse Etwas: Sie sorgen für kraftvolle Kontraste, lenken den Blick genau dorthin, wo man ihn haben will, und bringen Tiefe und Dynamik ins Bild. Einfach gesagt – sie sind ein Geheimrezept für mehr Wow-Effekt in deiner Kunst.
5. Farbharmonie und Farbschemata
Farbharmonie entsteht, wenn Farben miteinander kombiniert werden, sodass sie ein ausgewogenes und angenehmes Gesamtbild erzeugen. Hier ein paar bewährte Farbschemata.
Monochromatische Farbschemata: Diese bestehen aus verschiedenen Tönen, Sättigungen und Helligkeiten einer einzigen Farbe. D.h. eine Farbe in verschiedenen Abstufungen. Sie erzeugen ein ruhiges, elegantes und einheitliches Erscheinungsbild.
Analoge Farbschemata: Hierbei werden Farben verwendet, die im Farbkreis nebeneinander liegen. Diese Kombinationen wirken harmonisch und sind angenehm für das Auge.
Komplementäre Farbschemata: Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um die Kombination von Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen. Sie erzeugen einen starken Kontrast und können die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche lenken.
Die Wahl eines Farbschemas hängt von der gewünschten Wirkung und Stimmung auf ein Kunstwerk ab.
Einfach mal ausprobieren und schauen, was zu dir passt!
6. Farben sind launisch – Einfluss von Licht und Umgebung auf Farben
Farben solltest du nicht isoliert betrachten. Natürliches Licht, künstliche Beleuchtung und die Farben der umgebenden Objekte können die Wahrnehmung einer Farbe verändern.
Ein leuchtendes Rot kann bei Tageslicht strahlen, unter künstlichem Licht aber eher gedämpft wirken.
Ausserdem wirkt beispielsweise ein Grün auf einem roten Hintergrund anders als auf einem blauen.
Tipp: Achte darauf, wie deine Farben im Kunstwerk wirken, bevor du dich für eine Farbe entscheidest.
7. Praktische Tipps für das Farbmischen
Und zum Schluss noch ein paar Dinge, die dir das Farbmischen leichter machen:
Starte mit einer begrenzten Palette, um ein Gefühl für das Mischen zu entwickeln.
Halte den Farbkreis bereit: Ein gutes Verständnis des Farbkreises hilft, die Beziehungen zwischen den Farben zu erkennen und gezielt zu nutzen.
Experimentiere mit verschiedenen Farbschemata: Probiere verschiedene Kombinationen aus, um herauszufinden, was zu dir passt.
Berücksichtige Licht und Umgebung: Achte darauf, wie Licht und Umgebung die Wahrnehmung der Farben beeinflussen.
Übung macht den Meister: Farben verstehen kommt mit der Zeit, also hab Geduld mit dir.
Fazit: Farben lieben dich, wenn du sie verstehst
Farben sind wunderbare Begleiter – wenn du ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkst. Experimentiere, mische und entdecke, was für dich am besten funktioniert. Ob mit Öl, Acryl oder Epoxidharz – am Ende geht es darum, Spass zu haben und dein eigenes Farberlebnis zu schaffen.
Also los, hol dir deine Farben und leg los!
Herzlich, Patricia Jaggi
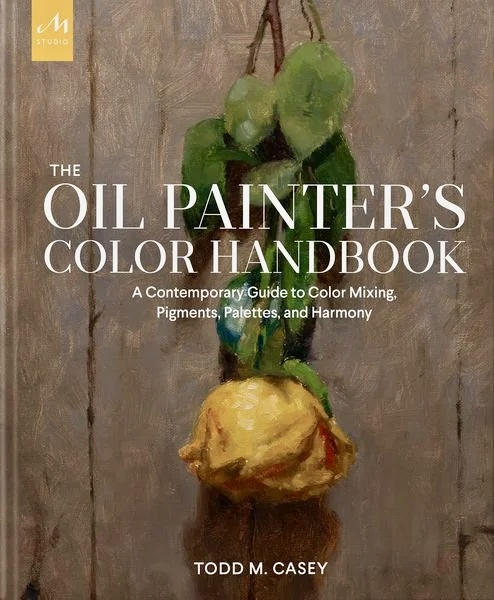




コメント